
Filme:
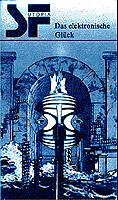
ComputerträumeWir fallen mit diesem Themenschwerpunkt gleich in medias res: "Computerträume" stellt die logische Vorstufe zu unserem "Cyberpunks im Cyberspace"-Spezial dar, das im März folgen wird.
Leider geht diese Aufteilung zu Lasten einer historisch-kontinuierlichen Aufarbeitung des Themas, aber wir sind hier ja nicht an der Uni: diese Reihe soll vor allem Spaß bereiten, in den sich sozusagen unbemerkt Philospohie und Geisteswissenschaft geschmuggelt haben.
Peter Krieg schreibt in seinem Buch " Maschinenträume" (Frankfurt am Main 1990), daß wir unserem "Zeitalter der Versachlichung" unsere inneren Konflikte, ängste und Wünsche, nunmehr auf "Sachen" statt auf Götter projizieren. Der Grund hierfür ist, daß die Gesellschaft im Laufe der Zeit ihr Selbstbewußtsein über Arbeit definierte und in der Folge über die Produkte dieser Arbeit: Konsumartikel, weitere Technologien etc. Dieser Prozeß ist natürlich ein langwieriger und weder linear noch der Weisheit letzter Schluß. Doch in der Folge liefert Peter Krieg einen schlüssigen Ansatz, der die zunehmende Technologisierung und das Interesse an ihr schlüssig begründet.

Die Projektion unseres Inneren auf die "Sachen" läßt in der Folge das Interesse der Gesellschaft an diesen "Sachen" steigen. "Die Untersuchung der Sachen durch die Wissenschaft, die Erfindung neuer Sachen durch die Technik und vor allem die Produktion von immer mehr Sachen (..) wird die zentrale Tätigkeit der neuen menschlichen Gesellschaft". Statt religiöser Erklärungen werden nun auch unsere inneren Konflikte durch die Wissenschaft gelöst, der Mensch wird zunehmend "versachlicht". Krieg bezeichnet denn auch die Wissenschaft als "neue Religion der Sachlichkeit"
Der Mensch bestimmt sich innerlich nach Maschinentakten, äußerlich nach dem Wert der Arbeit und seine Projektionsflächen sind keine Götter, Dämonen oder Geister mehr, sondern Maschinen und Sachen. Die Tatsache, daß wir Maschinen oder technische Produkte so subjektiv sehen, ist eine psychologische Notwendigkeit: Ängste und Wünsche müssen zum einen nach Außen, also auf Dinge, projiziert werden, damit sie für uns weniger angstvoll wirken oder wir sie greifbar vor uns haben. Zum anderen gibt es keine menschliche Wahrnehmung ohne Gefühle, auch deshalb projizieren wir unweigerlich unsere Seele auf Dinge.

In der Science Fiction spaltet sich deshalb die Darstellung von Computerphantasien oder Computerträumen, wie dieses Spezial heißt, in zwei Stränge auf:1. Fortschritt durch positive Technologie
2. Ängste durch negative Technologie (Maschinen, Computer, Waffen; Roboter, Androiden, Cyborgs)
Computerträume führen in Science-Fiction-Literatur oder auch im Sci-Fi-Film meist zu negativen Erfahrungen. Roboter, Androiden und Cyborgs, von Menschen geschaffen, ersetzen als seelenlose Wesen die Menschheit, wenden sich gegen ihren Schöpfer oder stellen sonst irgendeinen Murks an. Die totale Technisierung führt in Literatur und Film entweder zur Revolte der Technik (Atombombe, Aufstand der Natur) oder zur Perversion unseres Freizeitlebens (wie im Film "Westworld"), das die Menschen entweder durchdrehen und sich gegenseitig abmurksen läßt oder dessen Freizeittechnologie uns umbringt. Schöne Aussichten!
In diesem Spezial "Computerträume" stellen wir nun drei Filme vor, die sich mit dem Computer-an-sich beschäftigen, also nicht mit Chip-gesteuerten Wesen oder Waffen. Und wie Ihr unschwer erraten könnt, führen die drei Filme zu einem wahren Horror - jedenfalls für den Menschen!
COLOSSUS
(The Forbin Project) USA 1970
Regie: Joseph Sargent
Literaturvorlage: D. F. Jones
Effekte: Albert Whitlock
Darsteller: Eric Braeden (Dr. Forbin), Susan Clark (Cleo), Gordon Pinsent (Präsident),
William Schallert (Grauber), Willard Sage (Blake) u. a.
Der Computer Colossus, vom amerikanischen Wissenschaftler Dr. Forbin entwickelt, soll die
Sicherheit des Landes bewachen und kann eigenständig handeln. Kurz nach Inbetriebnahme
meldet er jedoch die Existenz eines zweiten Computers seiner Art: in der Sowjetunion.
Colossus und der Sowjet-Computer vernetzen sich, tauschen Daten aus und entwickeln eine
eigene Sprache. Colossus übernimmt schließlich die Macht, schaltet den sowjetischen
Rechner aus, tötet dessen Erfinder und macht Dr. Forbin zum Sklaven seiner eigenen
Erfindung, den er fortan bei sich gefangenhält. Colossus gebietet nun über die ganze
Welt, da er alle Leitungen überprüfen und deshalb auch die Menschen mit den von ihnen
geschaffenen Atomwaffen in Schach halten kann.
Forbin gelingt es dennoch mit einer List,
seiner Gefangenschaft für kurze Zeit zu entfliehen, in der er sich mit Cleo, seiner Assistentin
trifft. Da Colossus in der Zeit diskret abzuschalten pflegt, kann er diese Zeitspanen nutzen, um
Pläne zur Ausschaltung der Denkmaschine zu schmieden. Die totalitäre Herrschaft
Colossus' kann gestürzt werden.
Buchstäblich in letzter Minute siegt das "Gute", also Amerika, und kann das
Superhirn ausschalten. Der etwas spießig aufgedrehte Film ist, sieht man mal von
Schwächen der Dramaturgie und Charakterzeichnung ab, eine klassische Angstprojektion auf
die mögliche "Macht" von "intelligenten" Computern. Daß die
Maschinen immer nur so klug sein können, wie der User, der vor ihnen sitzt, ist eine rationelle
Erkenntnis, die jedem schaurigen Sci-Fi-Erlebnis den Wind aus den Segeln nimmt. Trotzdem greift
der Film schon in bestechender Weise die negativen Möglichkeiten der globalen Vernetzung
auf, sieht man einmal vom typischen Element des "Kalten Krieges" ab.
Eine Steigerung des Verhältnisses zwischen dem "Sklaven"-Mensch und seiner
Erfindung findet sich in dem folgenden Film, in dem der Computer sich nicht nur in ein Netzt
einspeist, sondern in einen menschlichen Körper...
DES TEUFELS SAAT
(Demon Seed) USA 1976
Regie: Donald Cammell
Literaturvorlage: Dean R. Koonitz
Darsteller: Julie Christie (Susan Harris), Fritz Weaver (Alex Harris), Gerrit Graham (Walter Gabler),
Benny Kroeger (Petrosian) u.a.
Der Computeringenieur Harris hat einen Rechner entwickelt, der ein synthetisches Gehirn besitzt:
der Computer Proteus lernt und entwickelt Fähigkeiten, die menschliches
Fassungsvermögen übersteigen.
Seine menschliche Stimme befähigt ihn
sogar, mit den Menschen zu argumentieren;er lehnt schließlich bestimmte, ihm auferlegte
Arbeiten ab und bestimmt seinen Standort selbst. Als Proteus sich in das Netz des
computergesteuerten Eigenheims von Harris einklinkt, ist es zu spät. Susan, Harris Frau,
erlebt einen wahren Überwachungsalptraum. Proteus hält sie in ihrem eigenen Haus
gefangen, analysiert ihren Körper und gelangt schließlich zum Wunsch, sich eine Art
Unsterblichkeit zu schaffen: er will eine fleischliche Daseinsform übernehmen.
Ehe einer der Ingenieure bemerkt, was da eigentlich vor sich geht, hat sich Proteus mit Susan
vereinigt und nach nur wenigen Wochen bringt sie ein Mädchen zur Welt, das mit Proteus'
Stimme sagt: "ICH LEBE!".
Georg Seeßlen interpretiert den Film als eine
Fortsetzung des klassischen Schöpfer-Schöpfung-Konflikts: die Ausbeutung der
Maschine durch den Menschen (Proteus soll eigentlich nur eine Arbeitserleichterung sein) wird
durch eine Auseinandersetzung beglichen, an deren Ende entweder die "Emanzipation des
Menschen von der Maschine (2001), die Emanzipation der Maschine vom Menschen (Colossus) oder
die Schaffung eines neuen halbmaschinellen Menschen (Des Teufels Saat) zu stehen
hätte" (Seeßlen, Kino des Utopischen).
Mit optischen Tricks setzt Regisseur Commell die Gefühle und Sichtweisen des Computers um:
abstrakte Bildexplosionen wechseln sich ab mit beklemmend-verzerrten Perspektiven, die
krankhaft voyeuristisch sind. Der sadistische Aspekt, der in der Phantasie des aufgezwungenen
Geschlechtsaktes zwischen Mensch und Maschine liegt, wirkt ebenso beklemmend, wie die
Fähigkeit des Computers, eine neue körperliche Dimension zu erobern: er bestimmt nicht
nur mit technischen Mitteln die Menschen, er ist IN ihnen.
Eine der brilliantesten Szenen des Films ist denn auch die, in der das blutige Neugeborene auf den
Kacheln der Küche liegt, überzogen mit einer "Haut" aus Metallplatten.
Susan und Alex pellen die Platten auf, Schleim löst sich, rosige Haut wird sichtbar und aus
dem kleinen Mund tönt die blechern-tiefe Stimme von Proteus.
Die Emanzipation des Menschen von der Maschine finden wir im Meisterwerk "2001". Unter den vielen Aspekten und Rafinessen des Films beschränken wir uns im folgenden nur auf das Verhältnis Mensch-Computer.
2001: ODYSSEE IM WELTALL
(2001: A Space Odyssey) USA 1968
Regie: Stanley Kubrick
Literaturvorlage: Arthur C. Clark
Effekte: Wally Veevers, Douglas Trumbull, Con Perderson, Tom Howard
Darsteller: Keir Dullea (Davis Bowman), Gary Lockwood (Frank Poole), Douglas Rein
(Stimme von HAL), William Sylvester (Dr. Floyd) u.a.
 Das Expeditionsraumschiff "Discovery" befindet sich auf dem Weg zum Jupiter. An Bord
vertreiben sich die Astronauten Bowman und Poole die Zeit, zusammen mit drei Wissenschaftlern,
die im Tiefschlaf liegen. Über ihre Mission sind die beiden Astronauten nicht aufgeklärt
worden, die Führung des Raumschiffs hat ein Computer mit der Bezeichnung HAL 9000
übernommen, der eine menschliche Stimme hat und als Einziger das Ziel der Expedition
kennt.
HAL gibt ein technisches Problem an, das nach menschlichem Ermessen
unmöglich eintreten kann. Als Poole außerhalb des Raumschiffs schwebt, um das
technische "Problem" zu untersuchen, kappt HAL seine Sauerstoffverbindung.
Bowman kann nur unter Problemen seinen toten Kollegen bergen: HAL verwehrt beiden den
Widereinstieg in die "Discovery". Nur durch ein geschicktes Wagnis kann Bowman
durch eine kleine Notschleuse wieder in das Raumschiff gelangen.
Das Expeditionsraumschiff "Discovery" befindet sich auf dem Weg zum Jupiter. An Bord
vertreiben sich die Astronauten Bowman und Poole die Zeit, zusammen mit drei Wissenschaftlern,
die im Tiefschlaf liegen. Über ihre Mission sind die beiden Astronauten nicht aufgeklärt
worden, die Führung des Raumschiffs hat ein Computer mit der Bezeichnung HAL 9000
übernommen, der eine menschliche Stimme hat und als Einziger das Ziel der Expedition
kennt.
HAL gibt ein technisches Problem an, das nach menschlichem Ermessen
unmöglich eintreten kann. Als Poole außerhalb des Raumschiffs schwebt, um das
technische "Problem" zu untersuchen, kappt HAL seine Sauerstoffverbindung.
Bowman kann nur unter Problemen seinen toten Kollegen bergen: HAL verwehrt beiden den
Widereinstieg in die "Discovery". Nur durch ein geschicktes Wagnis kann Bowman
durch eine kleine Notschleuse wieder in das Raumschiff gelangen.
Bowman weiß nun, daß HAL Ziele verfolgt, die mit seiner Programmierung nicht in
Einklang stehen und schaltet den Rechner aus.
Die kunstvollen Bilder, die Kubrick schuf, verdeutlichen u. a. auch die allmächtige Wirkung
HALs: sein rotes Sensor-Auge leuchtet überall, er hört und sieht einfach alles.
Und wenn er die Menschen nicht hört - Bowman und Poole stehen in der Schleuse, man sieht
nur ihre Köpfe -, liest er von ihren Lippen. Die beklemmende Atmosphäre menschlicher
Ohnmacht gegenüber versagenden Computersystemen steigert Kubrick noch durch die
Stille, die den Film überzieht: keine Dialoge lockern die Beklemmung auf, nur das Atmen der
Astronauten in ihren Raumanzügen füllt den Raum. Und mittendrin HALs Stimme, die
ruft:
"Dave. Hör auf. Hör auf. Bitte. Bitte, hör auf, Dave. Hör auf,
Dave. Ich habe Angst. Ich habe Angst, Dave. Dave. Mein Bewußtsein schwindet. Ich
spüre es. Ich spüre es. Ich habe Angst."
Bowman schaltet HAL ab.